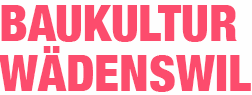Beerdigungsbräuche im früheren Wädenswil
Quelle: Wädenswil im Wandel der Zeiten, Wädenswil 1960, S. 77–80 von Peter Ziegler
Kirchenlader
Wenn heute jemand stirbt, wird der Hinschied durch eine Todesanzeige in der Zeitung bekanntgegeben. Diese Art von Mitteilung war in Wädenswil aber erst möglich, seit der «Allgemeine Anzeiger vom Zürichsee» erschien. Vorher war es – wie in allen Zürichsee Gemeinden – auch in Wädenswil Sitte, dass bei Todesfällen die Trauerfamilien das Leid im Dorf durch Boten ansagen liessen. Die Verkünder solcher Trauerbotschaften hiessen Kirchenlader, «Lychlader» oder Kirchgangansager. Meistens waren es vier Freunde oder Nachbarn des Verstorbenen, die sich in dieses Amt teilten. Am Tag vor der Beerdigung zogen sie in schwarzer Kleidung durch die vorher vereinbarten Dorfteile oder «Striche» und verkündeten von Haus zu Haus, von Familie zu Familie, wer gestorben sei. Die Trauerfamilie erwartete nämlich, dass aus jeder Haushaltung des Dorfes mindestens eine Person an der Beerdigung teilnahm. Das war damals nichts Aussergewöhnliches, sondern etwas ganz Selbstverständliches. Wädenswil hatte viel weniger Einwohner als heutzutage, und männiglich kannte sich noch. Und überdies hatte man Zeit, am Schicksal der Nachbarn Anteil zu nehmen.
Der Kirchgang-Ansager trug einen langen Stock bei sich, den «Chilestäcke» oder «Knöpflistecken», wie er in Küsnacht hiess. Mit diesem Stab pochte der «Lychlader» an die Fensterscheiben oder Haus- und Stubentüren; dann richtete er seine Botschaft aus. Zum Beispiel: «De Saagefieler Konrad Huuser im Herrlisberg laat bitte, es söll morn am zääni au öpper mit synere Frau sälig z Chile choo.» Wenn der Bote seine Nachricht mitgeteilt hatte, wurde er meistens noch bewirtet. Hier gab es Most, dort gab es Wein oder gar ein Mittagessen. Es war gut, wenn der Mann mit dem «Knöpflistecken» sich mit der kredenzten Tranksame einzuteilen wusste. Jedenfalls bot es ein betrübliches Bild, wenn der Leidansager des Abends toll und voll nach Hause wankte.
Kirche 1771: Der erste Wädenswiler Friedhof lag rund um die Kirche. Im Vordergrund links eine Bestattung. Zeichnung von J. J. Hofmann, 1771.
Glockengeläute und Todesanzeige
Das Kirchgang-Ansagen war zeitraubend, kostspielig und mit wachsender Bevölkerungszahl recht umständlich. Öfter war es vorgekommen, dass einzelne Familien bei der Benachrichtigung übergangen wurden, was dann und wann zu widerwärtigen Zwistigkeiten führte. Um diesen Übeln vorzubeugen, schlug ein Mitglied des Stillstands, der Kirchenpflege, im Jahre 1849 vor, man solle Beerdigungen künftig durch ein Zeichen mit den Kirchenglocken bekanntgeben. Man einigte sich auf die in Stäfa gebräuchliche Läutordnung und läutete fortan am Abend vor einer Beerdigung mit der grossen Glocke Betzeit.
Das Jahr 1853 brachte die entscheidende Wende. Am 4. Januar wurde die erste gedruckte Todesanzeige in die Häuser getragen; bald darauf erschienen derartige Bekanntmachungen im «Allgemeinen Anzeiger vom Zürichsee». Damit war das Kirchgang-Ansagen nicht mehr nötig; ein alter, schon 1711 erwähnter Brauch, hatte fortschrittlicheren Publikationsmethoden weichen müssen.
«Leid ergetzen»
Seit zirka 1800 wird in den Stillstandprotokollen wiederholt über den entarteten Brauch des «Leidergetzens» geklagt. Das «Leidergetzen» war früher die übliche, weit verbreitete Art des Kondolierens. Man schickte den Angehörigen eines Verstorbenen nicht wie heute eine Trauerkarte, sondern jedermann ging selbst hin, um den Hinterlassenen sein Beileid auszusprechen und sie im Schmerz zu trösten. So menschlich und feinsinnig diese Sitte auch war; sie führte dennoch mit der Zeit zu Unannehmlichkeiten. Im Jahre 1816 rügte der Stillstand besonders das Verhalten der Frauen, die, von Sensationslust und Neugier getrieben, jeder «Leidergetzeten» beiwohnten. Gar oft war es in der Stube des Trauerhauses, wo der offene Sarg stand, zu wüstem Gedränge und lästiger Unordnung gekommen. Der Gemeinderat verfügte daher, die Leidleute sollten künftig den Sarg vor dem Hause zur Schau stellen und dort die Kondolationen entgegennehmen.
Rudolf Streuli 1746 – 1811.
Bis sämtliche Leute, die an der Beerdigungsfeierlichkeit teilnehmen wollten, den Trauernden ihr Beileid ausgesprochen hatten, verstrich jeweils geraume Zeit. Was Wunder, wenn die Leichenzüge öfter eine viertel oder gar eine halbe Stunde verspätet in der Kirche erschienen! Vikar Häfeli versuchte dieser Unordnung zu steuern. Er bemühte sich, seiner Gemeinde die Nachteile und die Wertlosigkeit des «Leidergetzens» klarzulegen. Hatte man nicht genügend Beweise, dass diese Sitte bloss zu Ärger und Verdruss führte? Im Jahre 1838 hatten die kondolierenden Frauen vor der Beerdigung des Goldschmieds Blattmann im Trauerhaus ein arges Gedränge verursacht, «das für die Leidtragenden sehr ,genant' und im ganzen unanständig» gewesen war. Andere wieder beklagten sich, wenn die Frauen einmal im Hause seien, wollten sie nicht wieder weggehen und versperrten Leuten, die ebenfalls ihr Beileid bezeugen wollten, rücksichtslos den Weg. Der Stillstand richtete in der Folge am 3. Juni 1838 «eine ernste Ermahnung an das weibliche Geschlecht», gefruchtet hat sie allerdings nicht viel. Nach und nach gelang es aber doch, der überlebten und entarteten Sitte des «Leidergetzens» beizukommen.
Friedhof an der Oberdorfstrasse, 1818 bis 1908, abgeräumt um 1930.
Selbstmörder
Die Menschen des 18. und 19. Jahrhunderts vertraten zum Teil Lebensauffassungen, die sich nicht mehr mit den heutigen decken. Diese andere Einstellung zum Leben spiegelt sich besonders deutlich im Verhalten gegenüber Selbstmördern. Man wusste nicht um die Tragik eines Menschen, der freiwillig den Tod gewählt hatte. Man sah im Selbstmörder nicht mehr das Individuum, sondern eine Person, die ein schändliches Verbrechen begangen hatte. Und dieses Verbrechen musste noch im Tod gesühnt werden: Selbstmörder wurden daher stets zur Nachtzeit, ohne Glockengeläute und ohne Leichenzug auf einem Schlitten zu Grabe gezogen. Auf dem Friedhof setzte man die Leiche nicht in der angebrochenen Grabreihe bei, sondern man verscharrte sie auf einem abgelegenen Platz in der Nähe der Friedhofmauer.
Fromme, brave Bürger wollten diese Ordnung so ausgeführt wissen, selbst der Landvogt konnte dagegen nichts unternehmen. Landvogt Landolt bemühte sich im Jahre 1729 vergeblich, der freiwillig aus dem Leben geschiedenen Frau des Eichmüllers Blattmann auf dem Friedhof ein anständiges, geziemendes Grab zu verschaffen. Wutentbrannt rotteten sich viele Leute, darunter die Angesehensten des Dorfes, zusammen, um mit Hunden und Knütteln eine schickliche Beerdigung zu verhindern. Wiederholt wurde das Grab geschändet, und alle Vorstellungen des Landvogts, man solle doch endlich «solch lieblose Vorurteile gegenüber einem unglückhaften Menschen» aufgeben, waren umsonst.
Mit der Zeit fanden die humanen Gedanken der Aufklärung auch in Wädenswil Eingang, und man revidierte die Einstellung zu den Selbstmördern. Es kam zwar noch hie und da zu Auseinandersetzungen. Nach und nach gewannen aber die Leute mit humaner Gesinnung die Oberhand; ja 1808 zwangen sie sogar den Gemeinderat zu schicklicherem Handeln: Am 23. Oktober sollte die Gattin des Schützenmeisters Hauser, welche sich im Zustand der Depression in den Zürichsee gestürzt hatte, bestattet werden. Entgegen einem Entscheid des Obergerichts verfügte der Gemeinderat, die Frau müsse in aller Stille und ohne Grabgeläute auf dem Platz hinter der Kirche, wo man bis zur Revolutionszeit die Hintersässen beerdigt hatte, beigesetzt werden. Mehrere hundert empfindungslose Gaffer freuten sich auf die Sensation, drängten sich schon eine Stunde vor der Beerdigung um das leere Grab und vollführten einen ärgerlichen Lärm. Während der Gemeinderat und der Stillstand auf dem Gesellenhaus tagten, bewiesen einige Wädenswiler ihre humane Gesinnung. Entgegen der gemeinderätlichen Weisung versammelten sie sich in schwarzer Kleidung vor dem Trauerhaus, um der Gattin des Schützenmeisters Hauser in gewohnter Weise das Grabgeleit zu geben. Bei den Häusern ob der Kirche hielt aber der Gemeindeweibel den Leichenzug auf und stellte den tiefgebeugten Witwer barsch zur Rede. Da trat Administrator Leuthold vor und beklagte sich im Namen aller über das intolerante Benehmen des Gemeinderats. Er sagte unter anderem, «dass dies stille und geräuschlose Begleit keineswegs gegen den Beschluss des Gemeinderates sei. Vielmehr handle der Gemeinderat selber gegen diesen Beschluss, weil er schon 2 Stunden einen so unanständigen Lärm von ungesitteten Kindern und andern schlechtdenkenden Leuten um das Grab herum gestatte. Er glaube, dass ihm niemand verwehren könne, für die Verstorbene ein stilles Gebet zu verrichten, um sein Mitleid an den Tag zu legen.» Der Weibel brachte diese Worte dem Gemeinderat zur Kenntnis, und nach langem Warten erhielt das Leichengeleit endlich die Bewilligung, der Beerdigung beizuwohnen. Damit der Gemeinderat seinen Beschluss nicht widerrufen musste, befahl er, die Trauergemeinde habe dem Sarg voranzugehen; diese Aufstellung gelte dann nicht als Grabgeleit! Der Herr Pfarrer erschien in kirchlichem Ornat und hielt eine rührende Abdankungspredigt, die er sogar mit dem gewohnten Gebet schloss. Die Gemeinderäte sahen der Beerdigung vom Gesellenhaus her zu und überzeugten sich, dass ihr Beschluss – wie der Chronist der Lesegesellschaft bemerkte – «nicht mit der öffentlichen Meinung übereinstimmte» und «dass es weitaus dem grössten Teil der Gemeinde lieb gewesen wäre, wenn man nach dem Willen der höchsten Gerichtsbehörde gehandelt hätte».
Trotz dieses Vorfalls konnte sich der Gemeinderat nicht entschliessen, Selbstmörder künftig auf eine schicklichere Art und Weise zu bestatten. Es mussten nochmals 40 Jahre verstreichen, bis am 1. Juli 1849 eine Kirchgemeindeversammlung mit diesem Missbrauch endgültig aufräumte.
Friedhof in der Eidmatt um 1900.
Friedhof um 1900, Blick gegen Süden.
Peter Ziegler