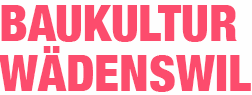Die Sagenwelt der Herrschaft Wädenswil
Quelle: Jahrbuch der Stadt Wädenswil 1986 von Prof. Dr. Albert Hauser
Der grosse, leider allzu früh verstorbene Volkskundler Richard Weiss hat die Zürcher Landschaft als «eine nicht gerade sagenreiche Region» bezeichnet. Das hat seine ganz bestimmten Gründe. Zunächst zwei geistesgeschichtliche Fakten: Unsere Vorfahren gehören zu den ersten, die im Zeitalter der Reformation zum «neuen Glauben» übertraten. Und man weiss, dass die Reformatoren brauchtumsfeindlich eingestellt waren. Auch die Sagen wurden, wenn nicht gerade abgelehnt, so jedenfalls nicht gefördert. Dazu kam im 18. Jahrhundert die Aufklärung; gefördert durch lesekundige Mariner, unterstützt durch die Lesegesellschaften (die Wädenswiler Lesegesellschaft gehört zu den ältesten unseres ganzen Landes), verbreitete sich der aufklärerische, rationale Geist schnell. Die Tradition, das alte Brauchtum, hörte bald auf, tragendes Element zu sein. Auf solchem Boden aber gedeihen die Sagen nicht.
Um das zu verstehen, sei auf eine Begebenheit hingewiesen, die zwar nicht dem Zürcher Sagensammler Glaettli, sondern dem bündnerischen Sagenforscher Büchli zustiess. Als er im Sommer 1959 in Rueras bei Disentis weilte, wo er schon früher Aufnahmen gemacht hatte, waren drei junge Damen aus München Gäste im Hause Cavegn. Die früher eifrige Erzählerin sprach unter Berufung auf das «Fräulein Doktor» (eine Medizinstudentin in den ersten Semestern) plötzlich geringschätzig von den mitgeteilten Geschichten, die ja eigentlich nur «tuppadas» (Dummheiten) seien. Mit dem Geld der Fremden war somit auch eine neue Denkart angenommen worden. Diese neue Denkart heisst nichts anderes als Aufklärung.
Aufklärung aber bedeutet Entzauberung oder nach Max Weber «das Wissen davon, oder den Glauben daran, dass man, wenn man nur wolle, es jederzeit erfahren könnte, dass es also prinzipiell keine geheimnisvollen, unberechenbaren Mächte gäbe, die da hineinspielen, dass man vielmehr alle Dinge − im Prinzip − durch Berechnung beherrschen könne.» Für den Aufgeklärten ist die Natur bis in ihre stofflichen und vitalen Kerne hinein nach Belieben auf- und umschmelzbar, sie ist entschleiert, enträtselt, durchschaut, formulierbar, manipulierbar. Seit der Aufklärung erleben wir die Natur nicht mehr als majestätisches System vorgegebener, gesetzhafter und logoshafter Ordnung. Es gibt keine Geheimnisse mehr, die uns mit Schauern von Ehrfurcht erfüllen würden. In diese Welt wollen die Sagen nicht mehr hineinpassen. Sie gehören einer andern Welt, der agrarischen, vorindustriellen Zeit an. Sie vertragen sich kaum mit der technischen Welt, mit der modernen Wissenschaft. Denn nach Auffassung der rationalistischen Aufklärung kann ja der Fortschritt, vereinfacht und überspitzt ausgedrückt, nur erzielt werden, indem man die überlieferten Normen und Gefühle beseitigt. Was unsere Vorfahren der verschiedensten sozialen Schichten gemeinsam auszeichnete, war ihre volkstümliche Haltung und Einstellung. Volkstümlich aber heisst traditionsgläubig: Was die Vorfahren sagen, ist recht. Man muss ihnen nur nachleben. Was von den Toten erschaffen wurde, darf nicht verändert werden. Man könnte ihren Zorn herausfordern. Alles hat seinen festen Platz, und alles kann auf seine Weise erklärt werden. Alles ist schliesslieh Gottes Schöpfung, und alles verläuft nach Gottes unerforschlichem Ratschluss. Die Sagenerzähler waren, wie Alois Senti ausdrücklich festhielt, gläubige Menschen, und das Sagengut erscheint im Wesentlichen als Bestandteil des übernommenen Glaubensgutes. Wo der Glauben verflacht und langsam erlischt, versiegen auch die Sagen. Was «bleibt, sind Schwundformen, die sich dem Schwank nähern, und dem Erzähler gerade noch gut genug sind, um sich auf Kosten jener, die daran glauben, lustig zu machen». Gleichgültig, welcher Konfession die Sagenerzähler angehörten: sie waren ihrem Glauben und ihrer Kirche zutiefst verpflichtet. Damit haben wir eine weitere Erklärung dafür, weshalb es im Kanton Zürich keine Sagenerzähler mehr gibt. Im Gegensatz zu katholischen Bergtälern ist bei uns eine allgemeine Säkularisierung eingetreten. Wir können das etwa am Kirchenbesuch der protestantischen Kirche ablesen.
Sagenerzähler − gäbe es sie noch −, hätten heute wohl keine Zuhörer mehr. Denn alle Abendsitze, Spinnstubeten, alle Dorfbänke, alle Hängerten oder Heimgärten, wie die Plätze genannt wurden, auf welchen sich Familienangehörige, Freunde, Nachbarn trafen, sind verschwunden. Oft hört man, das Radio und das Fernsehen hätten diese Abendgesellschaften verdrängt. Dies trifft indessen nur in einem gewissen Grade zu. Was die Erzählgemeinschaften zum Verschwinden, die Erzähler zum Verstummen brachte, es ist die andere Mentalität, die andere innere Haltung.
Alles dieses vor Augen, wundert es uns nicht allzu sehr, dass der einzige bedeutende Sagensammler, den unser Kanton aufweist, K. W. Glaettli, keine Feldforschung betrieben hat. Er hätte, als er von 1955 bis 1959 die Sagen sammelte, wohl gar keine Erzähler mehr gefunden. Sie waren weitgehend, wenn nicht vollständig, ausgestorben. Für unsere Region nennt er im Anhang seiner Sammlung auch nur zwei einzige Gewährsleute, eine Frau und einen Mann. Die Frau war Katharina Höhn-Leuthold (1824–1905). Sie erzählte eine Sage (Hüttnersee) ihrem Enkel, Walter Höhn-Ochsner, der sie im Neujahrsblatt der Lesegesellschaft Wädenswil von 1942 veröffentlichte. Der Mann war Landwirt: Albert Haab im Steinacher, gestorben 1955. Er hat einige Sagen aus der Franzosenzeit Peter Ziegler anvertraut. Dieser stellte sie Glaettli zur Verfügung, Die anderen Sagen entnahm Glaettli der Literatur, es war also «Material aus zweiter Hand». Man hat ihm dieses Vorgehen, insbesondere das Fehlen jeglicher Feldforschung, das heisst das Abhören von Sagenerzählern, auch vorgeworfen. Nachdem wir unsere Sagenlandschaft und deren Hintergründe etwa kennen gelernt haben, werden wir zweifellos nachsichtiger sein. Wir werden dies umso eher tun können, als Glaettli für unsere Region immerhin 23 Sagen zusammengestellt hat. Diese stammen aus allen drei Hauptgruppen, den «dämonischen», den historischen und den aitiologischen (erklärenden) Sagen. Zu den historischen Sagen gehören die Erzählungen aus der Franzosenzeit, in die Gruppe der «dämonischem» Sagen etwa die Hexen- und Chrungeli-Geschichten. Die Hüttnersee-Sage sowie die Dreiländerstein-Geschichte dagegen sind den erklärenden Sagen zuzurechnen.
Unsere Betrachtung leiten wir ein mit einigen «Franzosensagen», Sagen aus der Franzosenzeit (1798/99) gibt es fast in jeder schweizerischen Sagensammlung. Sie weichen nur in den Details voneinander ab. Oft wird sogar das Detail übernommen. Das gilt für die erste und zugleich knappste Sage, die wir aus unserer Region vorführen. Sie besteht aus zwei ganzen Sätzen: «Man weiss nicht mehr, ob es Kaiserliche oder Franzosen waren. Sie bestiegen die Bäume, hieben mit den Säbeln die Äste ab und verspeisten die Kirschen am Boden.» Wir können diese knappe Aussage abtun als banales Gerede. Man kann hier auch die Bezeichnung Sage streitig machen. Doch in diesen wirklich traumbildhaft eindringlichen Sätzen werden das ganze Elend und die ganze Not des Krieges verdichtet. Man kümmert sich nicht mehr um künftiges Wachstum; wir befinden uns hier auf dem unheimlichen Niemandsland, in welchem es gleichgültig ist, welche Untaten vollbracht werden, und wer sie vollbringt. Gerade die Klarheit der Sage bringt diese Situation eindringlich zum Sprechen und gibt ihr Gewicht und auch Bedeutung. Selbstverständlich wird in den Franzosensagen aus dieser Zeit auch das Heldentum der Erzähler deutlich. Das gilt für die Sage «De Tüütsch», die sich im Wädenswiler Berg abgespielt haben soll:
«Zur Franzosenzeit stand links von der Strasse, welche nach dem „Waggital“ führt, fast auf der „Aahöchi“, eine kleine Weidscheune. Dorthin wurde ein österreichischer Husar geschickt, um für die Pferde seiner Truppe Heu zu stehlen. Der Knecht, welcher eben das Jungvieh fütterte, tat, als ob er das vom Husaren geforderte Heu hole und stieg, vom Husaren gefolgt, auf den Heuboden hinauf. Unter dem Heuloch drehte sich der Knecht blitzschnell um und stiess seinen Feind hinunter. Die Leiche warf er in den Jauchetrog.
Unterdessen war das aufgescheuchte Pferd des Fremden ins Lager zurückgekehrt, und zwei Husaren, Schlimmes ahnend, machten sich auf den Weg, den vermissten Kameraden zu suchen. Sie kamen auch an der Weidscheune vorbei, wurden aber hier von Meister und Knecht irregeführt. Unglücklicherweise guckte ein Soldat in den Jauchetrog und sah den Stiefel seines vermissten Kameraden aus der Jauche ragen.
Die Österreicher wollten ihren Freund sofort rächen und griffen den Bauern und den Knecht an. Diese setzten sich jedoch zur Wehr und stachen die beiden Kriegsleute mit der Gabel tot. Dann begruben sie die Leichen in der Nähe. Da die Husaren schriftdeutsch redeten, nannte man jenes Stück Land, auf dem sie begraben liegen, „de Tüütsch“.»
Welcher List sich unsere Vorfahren etwa bedienten, um den Eindringlingen Herr zu werden, wird in der Sage «Die Franzosen auf dem "Chotten"» erzählt:
«Zwei Burschen hielten an einem Sonntag auf dem „Chotten“ Ausschau. Da sahen sie plötzlich vom „Strasshaus“ her eine Schwadron französischer Husaren anmarschieren. Sie nahmen an, die Feinde könnten am „Chotten“ vorbeikommen. Sie fassten daher den Entschluss, das Hornissennest in einer hohlen Eiche im „Chottenhölzli“ zu stören, um die Husaren dadurch an der Durchreise zu hindern. Mit Steinen wurden die Hornissen bombardiert. Dann zogen sich die Täter auf den Heustock in der Scheune zurück. Durch die Spalten der „Bschlächti“ wurde der Weg kontrolliert, und die Burschen konnten sehen, wie die Hornissen die Pferde und die Husaren angriffen. Die Pferde bäumten sich hoch auf vor Schmerz und versuchten durchzubrennen. Die hintersten der Husarentruppe wollten das Chottenhölzli umreiten. Der Kommandant gab die Erlaubnis aber nicht. Alle mussten am Hornissennest vorbeireiten. Dann schwärmten die Husaren aus und suchten die Missetäter, fanden sie aber nicht.»
In der nächsten Sage ist von einem listigen und beherzten Wädenswiler die Rede. Doch so ganz ohne Furcht und Tadel ist auch er nicht. Lassen wir den Erzähler, es ist der 1955 verstorbene Albert Haab, Landwirt im Steinacher, selber sprechen:
«Eine Abteilung französischer Husaren, welche die Aufgabe hatte, das Gebiet von Hirzel zu rekognoszieren, kam eines Nachts zum Strasshaus. Die Fremden zwangen einen Bewohner, ihnen den Weg nach Hirzel zu zeigen. Im Schein einer Laterne ging's voran Richtung „Kräh“, „Enderholz“, „Morgental“. Beim „Chruzelenmoos“ bemerkte der Wädenswiler, dass er in die Feuerlinie der in jener Gegend liegenden Österreicher gekommen war. Als Laternenträger war er in grosser Gefahr. Blitzschnell warf er das Licht in die Stauden und rannte ins Moos hinaus. Hier konnte er von den Berittenen nicht mehr verfolgt werden. Er hörte die Franzosen, die bereits im Moor eingesunken waren, fluchen und lästern. Seine Verfolgung konnten sie aber nicht mehr aufnehmen. Erst nach zwei Tagen soll sich der arme Mann wieder heim getraut haben.»
Sehr genau wird ein Zwischenfall auf Laubegg geschildert. Da kommen auch bestimmte Namen vor, und es ist durchaus möglich, dass sich die Geschichte dergestalt zugetragen hat:
«1799 wurde auf Laubegg, − andere meinen in Samstagern − , vor dem Hause des Bauern Bär ein österreichischer Soldat erschossen. Bärs Knecht nahm dem Krieger die Waffen ab und versorgte sie im Hause. Die Nachbarn schoben die Mordtat auf Bär hinaus und verklagten ihn bei den Österreichern. Diese durchsuchten das Haus und fanden die Waffen des Kameraden. Bär beteuerte seine Unschuld, wurde aber gleichwohl abgeführt. Geknebelt banden sie ihn zwischen zwei Rosse und schleppten ihn nach Bäch ins Lager. Das Militärgericht sprach das Todesurteil aus. Am folgenden Morgen sollte es bereits vollstreckt werden. Von diesem hatte mittlerweile auch Dr. Landis vernommen. Er war Bärs Freund. Er vermutete, dass Bär unschuldig sei. Sofort schickte er Boten an General Hotze nach Zürich. Unterdessen untersuchte man Bärs Haus nochmals und fand im Keller einen Franzosen, welcher den Österreicher erschossen hatte.»
Zur Sagenbildung regten immer auch Schlossruinen oder Schlossherren an. Das gilt für unsere Region für die Burgruine wie auch für den legendären, auf der Au residierenden General Werdmüller.
Beginnen wir mit der Sage vom Schatz auf Alt-WädenswiI. Der Leser oder Hörer wird sofort bemerken, dass sich in dieser Sage viele Motive finden, die auch in Märchen oder in anderen Sagen vorkommen. Es handelt sich dabei einmal mehr um Wandermotive, die lokalisiert worden sind. Dennoch hat die Sage ihre eigenen Reize:
«Um die Mitte des 16. Jahrhunderts wurde die alte, feste Burg zu Wädenswil abgetragen; nur ein einziger Turm trotzte noch lange dem Zahn der Zeit, wie ein ernster Wächter über die Kronen der Waldbäume in die lieblichen Gefilde hinunterblickend. In diesem Gemäuer hat einst ein armer Holzhacker ein wunderbares Schicksal erlebt, aber auch seine Lust nach Reichtum schwer gebüsst. Er war ein fleissiger Mann, der bei Arbeit und Sparsamkeit gesund und rüstig geblieben; weder er selbst noch sein treues Weib fühlten sich in ihrer Armut unglücklich.
Beginnen wir mit der Sage vom Schatz auf Alt-WädenswiI. Der Leser oder Hörer wird sofort bemerken, dass sich in dieser Sage viele Motive finden, die auch in Märchen oder in anderen Sagen vorkommen. Es handelt sich dabei einmal mehr um Wandermotive, die lokalisiert worden sind. Dennoch hat die Sage ihre eigenen Reize:
«Um die Mitte des 16. Jahrhunderts wurde die alte, feste Burg zu Wädenswil abgetragen; nur ein einziger Turm trotzte noch lange dem Zahn der Zeit, wie ein ernster Wächter über die Kronen der Waldbäume in die lieblichen Gefilde hinunterblickend. In diesem Gemäuer hat einst ein armer Holzhacker ein wunderbares Schicksal erlebt, aber auch seine Lust nach Reichtum schwer gebüsst. Er war ein fleissiger Mann, der bei Arbeit und Sparsamkeit gesund und rüstig geblieben; weder er selbst noch sein treues Weib fühlten sich in ihrer Armut unglücklich.
Als er einmal in der Nähe des alten Turmes arbeitete, hörte er in demselben ein ungewöhnliches Geräusch, und neugierig kletterte er hinauf, um durch eine Schiessscharte den inneren Raum übersehen zu können. Mit weIch freudiger Überraschung schaute er das Wunder, das sich ihm erschloss; denn zwei Zwerglein in langen, grauen Gewändern, mit silberweissen, bis zum Gürtel reichenden Bärten schleppten aus einer ihm unsichtbaren Türe silberne und goldene Becher und Gefässe, schimmernden Schmuck und seltene Münzen daher, gleichsam, um den in Nacht und Dunkel verborgenen Schätzen wieder einmal die Wohltat des lieben Sonnenscheins angedeihen zu lassen. Sprachlos starrte der geblendete Mann in das hell Gefunkel hinein, unbemerkt von den Zwergen, die in gesprächiger Geschäftigkeit walteten; aber ihr Verbündeter, ein Rabe, hatte den unberufenen Lauscher entdeckt und kündete ihn mit heiseren Gekrächze an, worauf unbegreiflich schnell der ganze Spuk verschwand. Nur das Knarren einer Tür verriet, das der Schatz im Turm selber liegen müsse. Aber umsonst suchte der genarrte Mann während dreier langer Tage die Spur einer Spalte oder Pforte; das Gemäuer schien so einsam wie immer, und schon ergab er sich mit grollender Unlust darein, ferner arm zu bleiben, bis die Versuchung ihm in Gestalt eines fahrenden Schülers sich nahte. Wie wenn der sonderbare Jüngling in sein Herz sehen würde, redete er ihm von den Reichtümern, die hier unbenützt unter ihrer Füssen lägen, und fachte so die kaum entschlummerte Habsucht zur heller Flamme an. Endlich versprach er dem begehrlichen Manne, ihm zur Hebung des Schatzes behilflich sein zu wollen, und beschied ihn auf die Mittagsstunde in die Ruine. Unter wunderlichen Gebärden und schaurigen Beschwörungen machte er den Erstaunten auf eine kleine Pforte aufmerksam, die bis jetzt seiner eifrigsten Nachforschung entgangen war, gab ihm eine Wünschelrute und wies ihn an, ohne umzublicken oder etwas zu berühren durch das Pförtlein bis zu den Schätzen hinzudringen, dort einmal wacker zuzugreifen, aber, wenn ihm Leib und Leben lieb seien, kein lautes Wort zu sprechen. Auf den ersten Schlag mit der Rute sprang die Tür knarrend auf, und der Holzhacker befand sich in einem geräumigen, von feuchtem Moderdufte erfüllten Gemache; doch brauchte er seine ganze Herzhaftigkeit, um nicht umzukehren; denn ein ganzes Heer von Schlangen und anderem Getier unheimlicher Art umlagerte seine Füsse, während hässliche Fledermäuse ihm den Weg zu einer zweiten Türe zu versperren schienen. Mutig machte er sich Bahn, und nach einem wiederholten Schlage öffnete sich auch diese Pforte; aber wie ganz anders sah es hier aus. Auf weichen Polstern lag eine liebliche Frauengestalt, die ihm mit anmutigen Gebärden einen Becher köstlichen Weines anbot. Zum Glück schwieg das Zauberwesen, und die tiefe Stille des in zartem Rosenglanz strahlenden Gewölbes schloss dem Betroffenen den Mund, so dass er, zu sich selbst kommend, ohne umzublicken standhaft an dem Weibe vorbei einer Flügeltüre zuschritt, die ihm die höchsten Schätze zu verbergen versprach.
Der Schatz auf Alt-Wädenswil. Zeichnung von Martin Usteri, 1821.
Der Schatz auf der Burgruine Wädenswil. Zeichnung von Martin Usteri, 1821.
Er hatte sich nicht geirrt; als auf den dritten Schlag die Türflügel wichen, breitete sich in blendender Pracht der ungeheure Schatz vor seinen Blicken aus; hier standen reich mit Edelsteinen geschmückte Gefässe ohne Zahl; dort lachte ihm aus den geöffneten Truhen der herrlichste Schmuck entgegen; ganze Kisten voll blanker Gold- und Silberstücke luden zum Zugreifen ein; alle diese Herrlichkeiten erleuchteten strahlend das hohe Gemach, als ob tausend Kerzen ihren Glanz verbreiteten. Aber O weh! Der Anblick dieser Kostbarkeiten überwältigte den Glücklichen, und es entfloh seinen Lippen der Freudenruf: „Herr Gott, wie viel!“ Im nämlichen Augenblick verschwand alles in tiefe Finsternis, und von einer heulenden Windsbraut erfasst, ward der Unselige emporgehoben, und erst am späten Abend kehrten seine Sinne wieder. An Leib und Seele zerschlagen, fand er sich einsam in dem alten Gemäuer; doch als er sich nach und nach des Geschehenen erinnerte, verging ihm auf immer die Habgier nach Reichtum.»
Etwas anders als in der Schloss-Sage verhält es sich mit der Sage um die Figur des Generals Werdmüller. Werdmüller war eine Persönlichkeit, die zur Sagen- und Legendenbildung selber Anlass geboten hat. Teils geschah dies ganz bewusst, teils wohl auch ungewollt. Eine Sage, die Glaettli nicht in seine Sagensammlung aufgenommen hat, die aber heute noch in Wädenswil erzählt wird, lautet wie folgt:
«Der General besass in seinem Park und in seinem Garten recht viele Fruchtbäume, die die Habenichtse von Wädenswil und aus der Au − vielleicht waren auch Horgner dabei −, unwiderstehlich anlockten. Um den überhandnehmenden Diebstahl einzudämmen, schickte Werdmüller einen seiner Knechte auf einen fruchttragenden Baum: Dort hatte er den sich anschleichenden Obstdieben wehklagend zuzurufen, er sei wegen Diebstahles auf den Baum gebannt und könne nicht mehr herunter. Darauf rannten die nicht zum Zuge kommenden Obstdiebe wie von der Tarantel gestochen davon.»
Der Moor des General Werdmüller. Bug- oder Galionsfigur des sagenumwobenen Weidlings. (Im Besitz der Familie v. Schulthess.)
Ausserdem hat die ungewöhnliche Lebensweise des Generals zahlreiche Fabeln ersinnen lassen. Weil er nachts in seiner Schmiede zu arbeiten pflegte, glaubte man, der General empfange nächtliche Besuche des Bösen, der ihm Hufeisen schmieden helfe: «Noch gegen Ende des 18. Jahrhunderts, als jene Werkstätte in eine Wohnung für das Gesinde umgeschaffen wurde, waren die guten Leute kaum zu überzeugen, dass es sich hier schlafen liesse, ohne Gefahr, von dem verstorbenen General geplagt, vielleicht gehämmert zu werden. Ja, der Aberglaube, der sich noch am letzten Stäudchen zu halten versucht, trieb es so weit zu behaupten, dass ein gewisses Stück Holz aus der alten Schmiede, welches zufällig eine ziemliche Weile auf dem Platze liegen blieb, gewiss nicht von der Stelle verrückt werden könne, ohne schreckliches Unheil anzurichten. Ausserdem besass Werdmüller eine Gondel, womit er zum Erstaunen schnell fuhr. Dass dies nicht mit natürlichen Mitteln zugehe, war bei den Leuten bald genug ausgemacht. Ja die Sache schien selbst seinen Obern so verdächtig, dass Werdmüller sich darüber bei ihnen zu verantworten hatte.»
Das Landhaus des General Werdmüllers auf der Au. Aquarell von J.K. Escher, 1673.
Auf Naturbeobachtungen basiert die hübsche Sage vom Hüttnersee. Allerdings hat die Sagenerzählerin ihre Beobachtungen falsch interpretiert. Aus der Tatsache, dass im Grund des Hüttnersees Baumstrünke liegen und an verlandeten Ufer die Erlen aus den Wasser ragen, schloss sie, dass hier einst kein See gewesen sei. In der Tat aber verhält es sich umgekehrt. Der Hüttnersee war noch vor hundert Jahren bedeutend grösser, und er ist seither infolge der Verlandung erheblich zusammengeschrumpft. Die Sage selber lautet:
«Es war vor vielen hundert Jahren. Da gab es noch keinen Hüttnersee. An seiner Stelle dehnte sich ein finsterer Tannenwald aus, durch den der alte Pilgerweg nach Einsiedeln führte, Mitten im Gehölz konnte man das Plätschern einer Quelle vernehmen, deren Wasser sich aus einem uralten Holztüchel ergoss. Das war der Pilgerbrunnen. Gerne erlabten sich hier die Wallfahrer im kühlen Schatten nach ihrer langen Wanderung, bevor sie den letzten Anstieg gegen die Schindellegi hinauf unter die Füsse nahmen.
Einst langte am Abend spät ein müder Pilger bei diesem Brunnen an. Er setzte sich neben dieser Quelle nieder, um etwas auszuruhen. Kaum hatte er sich auf dem weichen Moospolster des Waldbodens niedergelassen, als plötzlich ein Greis mit langem, weissem Bart aus dem Waldesdunkel vor ihm auftauchte. Er trug auf seinem Rücken ein Bündel Riedbesen, die er aus den langen Halmen der Riedbesenstreu kunstvoll gezöpfelt und geknüpft hatte. Weil er seit Jahrzehnten alljährlich aus dem Hochtal von Einsiedeln mit seinen Besenbündeln ins Zürichbiet herunterkam, war er dort jedermann unter dem Namen „Beselimaa“ bekannt.
Am Hüttnersee, um 1930.
Im Laufe des Gespräches, das die beiden anknüpften, erkundigte sich der Besenmann nach den Reiseplänen des Pilgers. Dieser erklärte ihm, dass er noch heute bis nach Maria Einsiedeln weiterwandern werde, um am übernächsten Tage wieder auf demselben Wege zurückzukehren. Da lachte der Greis laut auf und sprach: „Ja, du hast gut sagen! Wenn du übermorgen wieder auf diesem Weg zurückkehren willst, wirst du deinen Durst nicht mehr an diesem Brunnen stillen können. Frage aber nicht weiter „ Gott sei mit dir, leb wohl.“ Dann verschwand der Greis. Nachdenklich setzte der Pilger seinen Weg fort.
Als der Wallfahrer am zweitfolgenden Tag wiederum auf demselben Wege zurückkehrte, da wartete eine grosse Überraschung seiner. An Stelle des Waldes, den er vorgestern noch durch schritten hatte, breitete sich eine dunkle Seefläche vor ihm aus. Das Gehölz samt dem Pilgerbrunnen war in der Tiefe versunken. Nur rings am Ufer gewahr man noch hie und da Wipfel und Äste halb ertrunkener Tannen aus dem Wasser ragen.»
Bis vor wenigen Jahrzehnten glaubten die Umwohner des Seeleins, es sei unergründlich und habe einen unterirdischen Abfluss, der bei Wädenswil in den Zürichsee münde. Das Wasser des Hütnersees fliesst indessen, wie heute allgemein bekannt, ganz normal durch einen Bach ab.
Einzelne Sagen unserer Region entspringen dem Reich der Dämonie oder der von Peukert so bezeichneten zauberischen Bewusstseinslage. In diesen magischen Sagen von Hexen und Chrungerinnen finden wir all die «jenseitigen» Erscheinungen, die unseren Vorfahren und zuweilen auch uns so schwer zu schaffen machen. Dass auch in unserer Gegend zum Teil unabhängig, zum Teil gestützt auf Wandergut, gleiche Erscheinungsformen auftreten, kann man sicherlich auf den von Jung so genannten Archetypus zurückführen. Dieser Begriff und die zugrunde liegende Tatsache, dass die menschliche Fantasie nicht grenzenlos und chaotisch, sondern in einem gewissen Sinne auf das bestimmteste strukturiert ist, hat sowohl die volkskundliche wie auch die geschichtliche Forschung beschäftigt und auch zu mannigfachen Kontroversen geführt. Bedeutende Gelehrte aller Schattierungen, − zu nennen ist hier etwa Karl Schmid −,haben den von Jung geprägten Begriff längst in ihre Disziplinen eingeführt. Nach Jung ist der Archetypus «ein an sich leeres, formales Element, das nichts anderes ist als eine facultas praeformandi, eine apriori gegebene Möglichkeit der Vorstellungsform. Vererbt werden nicht die Vorstellungen, sondern die Formen, welche in dieser Hinsicht genau den ebenfalls formal bestimmten Instinkten entsprechen.» An diese Archetypen und an die Liebe für Symbole müssen wir denken, wenn wir in den Sagen auf übersinnliche Erscheinungen und Gestalten stossen. Schwierig wird die Sache allerdings dann, wenn ein Motiv nicht direkt von einer anderen Sage übernommen, sondern verwandelt wird. Das ist der Fall bei unserer Sage von der «Muetiseel». Das «Wilde Heer», das Heer der Toten, hat sich in dieser Sage bis zu einem gespenstischen weiblichen Dämon verfremdet und dabei auch den spezifischen Warnruf des «Wilden Heeres» übernommen.
Die Sage stammt aus unserer Nachbargemeinde Horgen:
«Wie im Oberland in Sternenberg und in Fischental, im Weinland in Flurlingen, im Unterland in Oberglatt, so gab es am Zürichsee, und zwar in Horgen, eine Muetiseel. Das war ein gespenstisches Ungeheuer, welches bei Neumond durch die Luft und gewissen Wegen nach stürmte und zu Hudlen und Fetzen zerriss, was ihm in den Weg kam. Es warnte mit rauem Geschrei die Leute, die sich zufällig auf seinem Weg befanden, mit dem Rufe:
«Drei Furen us em Wääg,
suscht schniid der d Bei ewäägl»
Die Umdeutung lag, wie Lutz Röhrich meint, nahe, da ja auch im Wilden Heer die Seelen abgeschiedener Toten mitziehen. Neben der «Muetiseel» gibt es aber auch in unserer Region eine ganze Anzahl von Lokaldämonen. Zu ihnen gehören die Chrungerin und der Isengrind. Die Sage der Chrungerin hat nach Glaettli folgenden Wortlaut:
«Am Zürichsee, namentlich am linken Ufer, und im Oberland geht ein altes, gespenstisches Weib um; es hat zwei Höcker, einen auf der Brust und einen auf dem Rücken, und an den Händen lange, scharfe Nägel. Sie ist hauptsächlich den Kindern feind, denen man mit ihrem Erscheinen droht, wenn sie nicht einschlafen wollen. Aber auch Erwachsene quält und peinigt sie, indem sie ihnen des Nachts als böser Alp zusammengekauert auf die Brust hockt und mit ihren langen Nägeln die Hälse zuschnürt, so dass sie am andern Morgen ganz elend anzusehen sind. Sie soll sich in einer schwer zugänglichen Höhle im Sihlsprung, im „Chrungelichaschte“, aufhalten. Diese Unholdin gab Anlass zur Veranstaltung der „Chrungelinacht“ an einem Abend zu Ende des Jahres, da vermummte junge Leute in die Häuser eindrangen und mit den Spinnerinnen allerlei Schabernack trieben und den Kindern bange machten. Ähnliche Gespenster, die umgingen, waren der „Böölimaa“, dem am Uetliberg eine Wohnung angewiesen ist, und der „Haaggerimaa“, ein bösartiger Wassergeist, der, in den Gewässern lauernd, seine Opfer mit einem langen Haken zu sich herab in die Tiefe zieht. Noch heute nennt man die dichten Schlingpflanzen am Seeufer „Haaggerimanne“.»
Ganz anders sah der Isengrind aus: «Der Isengrind ist ein Gespenst in Hundegestalt. Er hat feurige Augen und trägt Hörner. In einer Nacht zwischen Weihnacht und Neujahr macht er die Runde durchs Dorf Horgen. In einer Familie waren die Eltern just an jenem Abend ausgegangen, als der Isengrind umging. Die Kinder lagen auf dem Ofen. Da kam das Gespenst herein, nahm einen Knaben auf die Hörner und lief mit ihm fort.»
Gut vertreten sind in unserer Sagensammlung die eigentlichen Hexensagen:
«Im Hirzel vermutlich lebte einst eine Jungfer; man nannte sie nur das Berner Änni. Diese stand im Rufe einer Hexe. Wenn sie von jemandem Milch bekam, so gaben sicher dessen Kühe anderntags rote Milch.
Nun wohnte in ihrem Dörflein ein netter, junger Bursch. Dieser bekam an einer grossen Zehe plötzlich einen solchen erbärmlichen Schmerz, dass er wie rasend in der Stube umherhüpfte. Man wandte sich an den Arzt R. in T. Dieser gab verschiedene Mittel, aber umsonst. Eines Tages erschien er selbst beim Patienten. Die Erzählerin dieser Geschichte sah selbst, wie er das Gässlein heraufkam und sein Ross neben der Haustüre, wo der junge Karli wohnte, anband. Das Berner Änni wohnte nicht weit von dieser Tür, auf der andern Seite der Gasse.
Der Doktor gab dem Karli ein Heilmittel, das sie geheim halten mussten. Auch sagte er, es sei das letzte, das er gebe. Es werde bald jemand kommen und etwas entlehnen wollen, erklärte er, aber die Leute sollten beileibe nichts hergeben, sonst helfe alles nichts. Darauf verabschiedete sich der Doktor und ritt das Gässlein hinab. Nicht lange hernach erschien das Berner Änni und wollte Salz entlehnen. Als es ihm aber abgeschlagen wurde, begehrte es etwas anderes und so fünferlei. Als es gar nichts kriegte, fing es laut an zu weinen und anzuhalten. Aber es musste leer heim. Unterdessen hatte der Doktor sein Pferd dem Vater des Patienten übergeben, welchen er auf dem Felde arbeitend fand. Er befahl ihm, das Tier nach U ... H ... zu führen. Dann ging er wieder zurück zum Kranken.
Das Berner Änni, als es heimkam, setzte sich wieder zu seinem Spinnrad, tat vier oder fünf Züge, fiel plötzlich rückwärts über den Stuhl und war eine Leiche, just in dem Augenblick, als der Doktor wieder zu seinem Patienten eintrat.
Ich vergesse es meiner Lebtag nicht, erklärte die Erzählerin, die dabei war, als man das Berner Änni zu Grabe tragen wollte. Da kam ein Hase die Wiese herunter, lief zwischen den Häusern durch und unter dem Sarge des Änni weg ins Weite. Nur zwei Männer gingen hinter dem Sarge her. Der Bursch aber wurde von Stund an wieder gesund und ist jetzt (1859) Präsident.»
In dieser vielschichtigen Sage geht es zunächst um die Bewältigung des Problems des Bösen. Die Hexe ist die Personifikation des Bösen schlechthin. Für sie ist alles machbar. Sie verwandelt weisse in rote Milch − eine Erscheinung, die wir schon in den Zürcher Hexenprozessakten des 16. Jahrhunderts finden. Die Erklärung ist «einfach» oder war es für die damaligen «unaufgeklärten», im Banne des Aberwissens stehenden Menschen: gab eine Kuh weniger Milch oder, noch schlimmer, gerötete Milch, so war sie eben behext; das aber hiess: eine Hexe steckte dahinter. In unserer Sage freilich wird die Hexe nicht hingerichtet; sie stirbt ganz plötzlich; aber selbst ihr Begräbnis ist «verhext», springt doch plötzlich ein Hase unter dem Sarg hin-durch ... Und tröstlich endet die Sage, ganz ähnlich wie im Märchen: Der Bursch aber wurde von Stund an wieder gesund - und stieg gar in höhere Ämter auf!
Ganz anders endet die folgende Sage. Sie basiert auf dem alten Glauben, dass eben Hexen nicht nur fluchen, sondern weit schlimmer, auch verfluchen können. Hier der Text:
Hexenverbrennung in Zürich, um 1560.
«In Wädenswil war ein armes Fräuli, das mit allerhand Waren hausierte. Kaufte man ihm nichts ab, fluchte es einem Unglück an. Einmal hatte es seinen Korb vor einem Haus abgestellt. Da machte ein spitzbübischer Kupferschmied ihn an die Bank. Als das Fräuli wieder herauskam, konnte es natürlich den Korb nicht wegheben. Es schimpfte und fluchte laut, dass alle Leute es hören konnten: Die zwei, dies getan haben, müssen binnen Jahresfrist sterben!' So geschah es.»
Etwas anders strukturiert die nächste Sage. Sie spendet uns eine gewisse Zuversicht: Wenn man weiss, mit dem Bösen umzugehen, kann man es überlisten − aber eben nicht immer:
«Eine Frau in Wädenswil wollte in einem Haus Waren verkaufen. Man sah sie aber in jenem Hause nicht gern als Hausiererin. Deshalb stellte man einen Besen aufrecht gekehrt vor das Haus und streute drei Hämpfeli Salz darauf. Drei Jahre lang blieb die Hausiererin weg; im vierten kam sie wieder. Darauf starb in jenem Hause ein Knabe.»
Drei Hämpfeli Salz ist hier das Mittel: Dreizahl = Dreifaltigkeit.
In der folgenden Sage tritt ein aufgeklärter Pfarrer in Erscheinung. Dies kommt beileibe nicht von ungefähr: Die Pfarrer haben seit dem 18. Jahrhundert immer wieder versucht, den Aberglauben auszurotten, − wie wir heute wissen, ohne allzu grosse Resultate. Gewandelt haben sich nur die äusseren Formen des Aberglaubens, auch der moderne Mensch ist − zahlreiche Ausnahmen vorbehalten − irgendwie abergläubisch. Doch nun zu unserer Sage:
«Unser Nachbar hatte eine Tochter im Alter von elf bis zwölf Jahren. Diese wurde behext, indem ihr eine Hexe in den Mund atmen konnte. Das Kind konnte, wenn es bei uns war, plötzlich zur Stube hinausspringen, indem es ausrief: „Seht ihr sie! Seht ihr sie!“ Und dann zeigte es auf die nur für es sichtbare Hexe. Ja, einmal zerarbeitete und zerschlug es sich ordentlich an derselben. Dann troolete es in der Stube herum und ins Bett hinein und wieder heraus. Eines Tages kam Herr Pfarrer N. N., das Kind besuchen. Das blickte ihn anfangs starr an. Verwundert fragte er des Kindes Eltern, warum das geschehe. Diese sagten ihm, er solle nur sein rotes Halstuch, das er trage, zudecken. Das tat er, und das Kind sah ihn nicht mehr so an. Der Pfarrer schärfte den Eltern strenge ein, doch ja an dem Kinde nicht weiter abergläubische Mittel zu versuchen. Aber es half überhaupt kein Mittel.
Nun konnten die Eltern ein Bündel bekommen, das sie dem Kinde in die Tasche taten. Aber nun hätte einer das Krachen hören sollen, das durch das ganze Haus fuhr. Sie liessen sich aber nicht abschrecken. Einmal nahm das Kind das Bündel aus der Tasche heraus und warf es in den Winkel. Da hätte man sehen sollen, wie das Bündel in der Stube herumflog, so dass man's schier nicht mehr erwischen konnte. Nun nähten sie es dem Kinde zwischen das Futter, und es genas.»
In der folgenden Geschichte kommt nochmals ein Besen vor. Seit dem 16. Jahrhundert ist der Besen das Symbol der Hexe. Es gab ja, wie wir alle wissen, Hexen, die den Besenstiel zum nächtlichen Ausritt benützten. Zum Glück für unsere Vorfahren aber existierten auch «Gegenmittel»: Man stellte den Besen umgekehrt auf ... Doch lassen wir den unbekannten Erzähler selber sprechen:
«Eine junge Frau hatte ein Kind von etwa drei Vierteljahren. Als sie einmal einige Tage von zu Hause fort musste, übergab sie das Kind seiner Gotte zur Obhut. Als des Kindes Mutter fort war, kam eine alte Frau, eine Hexe, zu der Gotte. Als sie das Kindlein sah, konnte sie nicht genug tun, wie das doch auch ein schönes Kind sei; sie sollten ihm all weg nur Sorge haben, es werde nicht alt. Nachts darauf hörte die Gotte in der Stube, darin das Kind schlief, laut rumpeln. Sie stand auf, und siehe da, das Kind lag nackend und auf dem Angesicht in der Stube draussen. Sein Bettlein war aber zugedeckt und in bester Ordnung. Sie legte es wieder hinein, aber zum zweiten Male wurde das arme Kind auf den Stubenboden gelegt. Nun stellte die Gotte den Besen zunderobsi, und die Hexe hatte keine Gewalt mehr. Denn eine Hexe war's, und nichts anderes, die das Kind auf den Stubenboden gelegt hatte.» Der Hexenglaube war in unserer Gegend zu vielen «Varianten» fähig. In der nächsten Geschichte sind es ausnahmsweise Buben, die «verhext» sind:
«An einem Orte (in unserer Gegend) wunderte sich der Hausvater, wie doch das viele Brot, das er alle Morgen im Küchenschrank fand, über Nacht in sein Haus komme. Weil er es dem Brot ansah, von welchem Bäcker es war, so ging er zu diesem und bat ihn, doch kein Weites und Breites zu machen. Wenn ihm wieder Brot abhanden komme, so solle er es nur ihm sagen, er werde es ihm vergüten. Seine Buben waren nämlich behext und konnten das Brot holen, ohne dass es jemand merkte.»
Zum Urtyp der Hexensage gehört die folgende, aus der Nachbargemeinde Horgen überlieferte Sage:
«In der Gegend von Horgen erzählte man sich: Die Hexen ritten des Nachts auch aus. Das ging so zu: Sie standen auf die Chouscht, nahmen den Besen zwischen die Beine − und fort ging's zum Dach hinaus durch die Luft. Hätte man nun den Leib einer Hexe, der unterdessen wie tot im Bette lag, umgewendet, das Gesicht nach unten, so hätte sie sterben müssen, denn die Seele, die von der Reise zurückgekommen wäre, hätte den Weg nicht mehr in den Leib zurückgefunden.»
Diese Sage ist ein schönes Beispiel dafür, dass Sagen, vom Lokalkolorit abgesehen, von gleicher Art sind. Mit Hilfe des Teufels können sich Hexen in Tiere verwandeln: in schwarze Katzen, Füchse oder aber, wie in unserem Beispiel, in Elstern. Manche Sagenmotive sind in der ganzen Schweiz, ja in vielen andern Ländern Europa verbreitet. Und sie treten oft unabhängig voneinander auf. Nicht umsonst hat C. G. Jung vom kollektiven Unterbewusstsein gesprochen ... Dass Hexen Schlafende würgen können, war zum Beispiel an vielen Orten bekannt. Lediglich die Bezeichnungen änderten im Laufe der Zeit. Renward Cysat, einer der ersten Sagensammler, hat im 16. Jahrhundert von würgenden Toggeli gesprochen. Sicher geht es um die gleiche Erscheinung, die in der folgenden Sage beschrieben wird:
«Eine Erzählerin versicherte, es sei ihr einmal nachts eine Hexe auf die Brust gesessen und habe sie am Halse abscheulich gewürgt, dass sie nicht imstande gewesen sei, um Hilfe zu rufen, obschon sie ihr Äusserstes aufgeboten. Erst als sie der Hexe einen rechten Fluch angehängt, habe diese sie Iosgelassen.» Wieder ist in dieser Sage angedeutet, welche Mittel in der Abwehr des Bösen zur Verfügung stehen. Hier ist es der Fluch, in anderen Geschichten ist es das Gebet. Die letzte Sage aus der kleinen Serie der dämonischen Sagen hat einen historischen Hintergrund. Die «Wattenbüelerin», eine arme Frau, die zur Hexe gestempelt, ihren Leidensweg bis zum bitteren Ende auf dem Scheiterhaufen gehen musste, stammte aus Horgen. Die Prozessakten aus dem 16. Jahrhundert liegen im Staatsarchiv. Von ihr erzählte man sich:
«Die hatte ein Unwetter verursacht, welches die Reben bös verwüstete. Auch nahm sie einigen Kühen die Milch; das heisst, sie verzauberte das Vieh, dass es keine Milch geben konnte. Ja, einige hatten sie gesehen, als sie bei der Kapelle St. Niklaus auf einem Wolfe ritt.
Für einen gewissen Zauber brauchte sie auch einmal ein Männerherz. Als sie einen Mann ausfindig gemacht hatte, dessen Herz ihr den beabsichtigten Zweck erfüllen sollte, redete sie ihn drum an. Der aber wollte sein Herz nicht an eine Hexe verschenken. Jetzt wurde das Weib bös und drohte ihm, sie wolle es dennoch haben, und ihm eines aus Stroh einsetzen.
Sie war aber an den Lätzen geraten, denn der Bursche und andere Horgener, denen sie zuleid gewerkt hatte, verklagten sie. Sie wurde verbrannt.»
In dieser Sage treten alle «klassischen» Merkmale der Hexensagen zu Tage: Ein Unwetter verwüstet die Reben, die Kühe geben wenig Milch − das musste ja irgend eine Ursache haben −, da war das Böse im Spiel. Und schon deutete das Volk auf irgendein armes Weiblein, das sich «verdächtig» gemacht hatte, das im Rufe stand, mehr zu können als irgendeine gewöhnliche Frau. Ja, einige wollten gar gesehen haben, so erzählte man sich hinter vorgehaltener Hand, dass sie − welch ein unheimliches Zusammentreffen − bei einer «heiligen» Stätte der St.-Niklaus-Kapelle, auf einem Wolfe ritt. Als da gar eine Liebesgeschichte hinzukam, wurde es zuviel: Ein Bursche und andere, «denen sie zuleid gewerkt hatte», lieferten sie dem gnadenlosen Richter aus.
Zum Schluss die Sage vom Dreifingerstein: «Wenn man von der Alp auf dem Rossberg den steilen Bergpfad zur Hohen Rohne hinaufsteigt, wo die drei Kantone Zürich, Schwyz und Zug zusammenstossen, kommt man bei einem mächtigen Granitblock vorbei, der in der Umgebung unter dem Namen Dreifingerstein bekannt ist. Bei näherer Betrachtung rechtfertigt sich diese sonderbare Benennung dadurch, dass man oben Vertiefungen wahrnimmt, die so aussehen, als ob sie durch das Hineinstecken eines Daumens, eines Zeig- und Mittelfingers entstanden wären. Vom Ursprung dieser Löcher erzählt die Volkssage folgendes:
Zum Schluss die Sage vom Dreifingerstein: «Wenn man von der Alp auf dem Rossberg den steilen Bergpfad zur Hohen Rohne hinaufsteigt, wo die drei Kantone Zürich, Schwyz und Zug zusammenstossen, kommt man bei einem mächtigen Granitblock vorbei, der in der Umgebung unter dem Namen Dreifingerstein bekannt ist. Bei näherer Betrachtung rechtfertigt sich diese sonderbare Benennung dadurch, dass man oben Vertiefungen wahrnimmt, die so aussehen, als ob sie durch das Hineinstecken eines Daumens, eines Zeig- und Mittelfingers entstanden wären. Vom Ursprung dieser Löcher erzählt die Volkssage folgendes:
Ein reicher und habsüchtiger Senn machte nach dem Hinschied des Besitzers auf Alp und Wald ungerechten Anspruch. Seine Forderung geschah auf Kosten der Kinder des Verstorbenen, die durch den Verlust dieser Grundstücke arme Waisen geworden wären. Falsche Verschreibungen und Dokumente unterstützten die Ansprüche des Betrügers; die armen Kinder hatten nichts als ihr inneres, gutes Recht. Es kam zum richterlichen Augenschein und zum Eidschwur. Der Bösewicht leistete ihn mit aufgehobenen Schwörfingern auf der Höhe des Felsens, laut und frech. „Weh dir“, rief ihm der Richter zu, „wenn du einen falschen Eid getan!“ Da stiess der Mann auf dem Felsen die ärgsten Beteuerungen aus, wie ihn der Teufel holen solle, wenn er die Unwahrheit beschworen: „So wenig als ich meine Schwörfinger in diesen harten Stein tauchen mag, so wenig habe ich einen falschen Eid getan“, rief er aus. Und damit setzte er in grausiger Vermessenheit die Finger auf den Stein, als ob er dieselben hineindrücken wollte. Und siehe, der Felsen gab nach wie weicher Schnee, und die drei Schwörfinger begruben sich darin bis ans hinterste Gelenk. Entsetzt wollte er sie alsbald zurückziehen: sie waren aber festgewachsen, und all sein Mühen und die Arbeit anderer fruchteten nichts; Gott hatte gerichtet, und der Fälscher bekannte sein Verbrechen vor allen Anwesenden. Und nachdem er gebeichtet, erbebte die Erde, die Föhrenzweige rauschten schauerlich, und aus dem Walde fuhr unter Blitz und Donner eine schwarze Wolke. Diese umhüllte ihn, und ein lautes Geschrei erhob sich in derselben; dann zerteilte sie sich und zerfloss in der Luft. Der Verbrecher aber lag entseelt auf dem Granitstein.»
In dieser Sage wird versucht, die Entstehung eines heute noch vorhandenen Felsbrockens zu deuten.
Dreiländerstein auf der Hohen Rohne.
Aber diese erklärende, aitiologische Sage ist gleichzeitig auch eine Warnsage, denn der Mann, der im Mittelpunkt der Erzählung steht, hat einen falschen Eid getan; er wird deshalb auch von der allerhöchsten Instanz, von Gott selber, gerichtet.
Gesamthaft betrachtet sind die Sagen aus unserer Region (wie überhaupt alle Sagen!) keine harmlosen Geschichtlein. Schrecklichste Dinge ereignen sich, das Böse tritt mit voller Wucht und hässlich zu Tage. Doch die Sage bietet auch Halt und Trost − schon allein durch ihre Deutung. Gleichzeitig macht sie, indem sie Unvertrautes, Unheimliches mithineinwebt, unsere Landschaft auch zur Heimat. Unsere regionalen Sagen zeigen aber auch, dass in ihnen die gleichen Erscheinungsformen zu finden sind, wie in anderen Gebieten. Husarenstücklein, Hexengeschichten, Frevel- und Meineidsgeschichten, wie etwa die Sage vom Dreifingerstein, gibt es auch in Bündner-, Urner oder Sarganser Sagen. Wie wir feststellten, ist die Tatsache, dass unabhängig voneinander an verschiedenen Orten die gleichen Dinge erzählt worden sind, auf den Jung‘schen Archetypus zurückzuführen.
Dieser Begriff und die zu Grunde liegende Tatsache, dass die menschliche Fantasie nicht grenzenlos und chaotisch, sondern in einem gewissen Sinne auf das bestimmteste strukturiert ist, hat sowohl die volkskundliche als auch die geschichtliche Forschung beschäftigt und zu mannigfachen Kontroversen geführt. Ohne diesen Begriff kommt heute die Sagenforschung nicht aus. Die Sagen, und das gilt auch für unsere Sagen, mit rationaler Kritik zu verwerfen, führt ja nicht weiter. Sehr bald erweist sich dies sogar als sinnlos: «Das symbolische Verständnis ist für uns die einzige Möglichkeit, diesen 'alten' Geschichten gerecht zu werden und ihre Wahrheiten zu bewahren.» (Isler) Wer diese Welt richtig verstehen will, wer die Sagen − insbesondere die Sagen aus der Herrschaft Wädenswil − verstehen will, darf sie nicht nur als Erdichtetes betrachten, als buntes Bild erleben, vielmehr muss er ihnen auch eine bestimmte und gewisse Wahrheit zugestehen. Das gilt insbesondere für das letzte Beispiel aus der kleinen Sagensammlung der Herrschaft Wädenswil. Wer könnte nach der Lektüre dieser Erzählung behaupten, dass uns alles nichts angeht? Dass diese alten Geschichten uns nichts mehr zu sagen haben? Geht nicht das Böse in unserer heutigen Welt weiter um? Ist nicht die Frage nach dem Leidenden, Unerlösten und Abgründigen, wirklich Bösen, das sich in unserer Sage offenbart, auch das eigentliche Problem unserer Zeit? Sind wir denn ganz sicher, dass das, was dem alten Weltbild selbstverständlich war, nämlich dass Unwetter, Hungersnot und alle Übel der Welt mit der malignitas des Menschen zusammenhängen, letztlich auf unserem gestörten Verhältnis zu Gott beruht, dass das nicht seine Richtigkeit hatte? Lange genug hat die moderne Wissenschaft viele Phänomene, welche in den Sagen mit bestürzender Eindringlichkeit zu Tage treten, in den Bereich der Fabel gewiesen. Jetzt müssten wir eigentlich, um Gotthilf Isler zu zitieren, um Auffassungen ringen, die «den Erscheinungen in ihrer ganzen Grösse gerecht werden können.»
Prof. Dr. Albert Hauser
Quellen und Literatur
Glaettli K. W., Zürcher Sagen. Zürich 1959. (vergriffen)
Sagen der Schweiz. Herausgeber: Peter Keckeis. Band Zürich, Zürich 1986.
Zur Sagen-Problematik:
Röhrich L., Sage und Märchen. Erzählforschung heute. Freiburg i.Br. 1976.
Isler G., Die Sennenpuppe. Basel 1971.
lsler G., Synchronizitäten in Erlebnissagen. Schweiz. Archiv für Volkskunde, 80. Jahrgang, Basel 1984, Heft 1/2.
Lüthi M., Volksliteratur und Hochliteratur. Bern und München 1970.
Fehr H., Das Recht in den Sagen der Schweiz. Frauenfeld 1985.
Hauser A., Waldgeister und Holzfäller. Der Wald in der schweizerischen Volkssage. Zürich und München 1980.